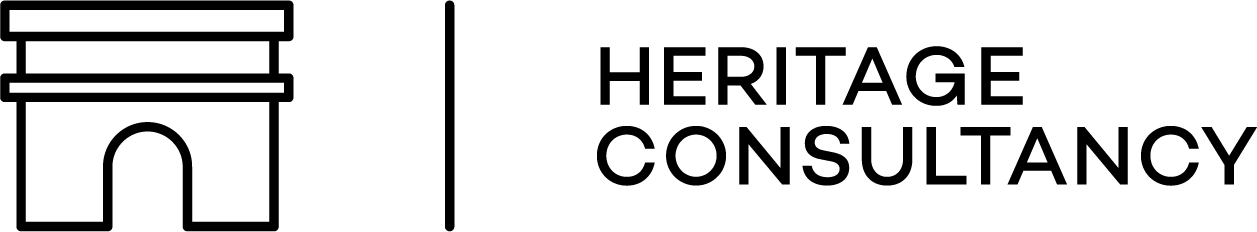Häufig gestellte Fragen.
WELTERBE ODER WELTKULTURERBE?
Es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen Welterbe und Weltkulturerbe:
Welterbe ist der allgemeine Oberbegriff. Er umfasst alle Stätten, die von der UNESCO in die Welterbeliste aufgenommen wurden – also sowohl Natur- als auch Kulturerbe.
Weltkulturerbe ist eine Unterkategorie des Welterbes. Dazu gehören Stätten von besonderer kultureller Bedeutung für die Menschheit – zum Beispiel die Pyramiden von Gizeh, der Kölner Dom oder die Chinesische Mauer.
Zudem gibt es auch das Weltnaturerbe. Das sind Naturstätten von herausragendem universellen Wert – zum Beispiel der Grand Canyon, das Great Barrier Reef oder das Wattenmeer.
Was Bedeutet UNESCO?
Die UNESCO ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen.
Der Name steht für:
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(auf Deutsch: Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur).
Förderung von Bildung weltweit
Unterstützung von Wissenschaft und internationaler Zusammenarbeit
Schutz und Förderung von Kultur, dazu gehört auch die Welterbeliste
Einsatz für Meinungsfreiheit und freie Medien
Die UNESCO wurde 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, mit dem Ziel, durch Zusammenarbeit in Bildung, Wissenschaft und Kultur den Frieden zu sichern.
Was Bedeutet RAtifizierung?
Die "Ratifizierung UNESCO" bezeichnet den Prozess, bei dem ein Staat ein UNESCO-Übereinkommen durch seine nationale Gesetzgebung annimmt und sich damit völkerrechtlich verpflichtet, dessen Ziele umzusetzen. Deutschland hat zum Beispiel 2007 das Übereinkommen zur Vielfalt kultureller Ausdrucksformen ratifiziert und ist 2013 dem Übereinkommen zum Schutz des Immateriellen Kulturerbes beigetreten. Die Welterbekonvention wurde 1976 bereits von Deutschland ratifiziert.
Was ist die Welterbekonvention?
Die Welterbekonvention ist ein UNESCO-Abkommen von 1972 mit dem Ziel, Kultur- und Naturstätten von außergewöhnlicher Bedeutung für die gesamte Menschheit zu schützen. Die Mitgliedsstaaten verpflichten sich darin, ihr Erbe zu bewahren und es an kommende Generationen weiterzugeben. Im Gegenzug können sie internationale Unterstützung erhalten, etwa finanzielle Hilfe oder fachliche Beratung.
Die wichtigste Folge der Konvention ist die Welterbeliste, auf der Stätten eingetragen werden, die einen „außergewöhnlichen universellen Wert“ besitzen. Über die Aufnahme entscheidet das Welterbekomitee. Damit ist die Konvention eines der erfolgreichsten Instrumente für den Schutz von Kultur und Natur weltweit.
Wie genau sie umgesetzt werde müssen steh t in “The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention” (auf Deutsch: Die operativen Richtlinien für die Umsetzung der Welterbekonvention).
Was SIND die Operational Guidelines?
Die Operational Guidelines der UNESCO sind das zentrale Regelwerk für die Umsetzung des Welterbe-Übereinkommens. Sie beschreiben, wie Stätten auf die Welterbeliste gelangen können, welche Kriterien dafür erfüllt sein müssen und wie ihr Schutz langfristig gesichert werden soll. Zunächst legen sie fest, dass jeder Mitgliedsstaat eine Vorschlagsliste, die sogenannte Tentative List, erstellt. Nur Stätten, die dort aufgeführt sind, können überhaupt für das Welterbe nominiert werden. Für die Aufnahme muss eine Stätte einen außergewöhnlichen universellen Wert besitzen, den die UNESCO anhand von zehn Kriterien beurteilt – sechs für Kulturstätten und vier für Naturstätten. Die eigentliche Prüfung übernimmt die UNESCO jedoch nicht allein: Fachgremien wie ICOMOS für Kultur und IUCN für Natur bewerten die eingereichten Dossiers und geben Empfehlungen ab, bevor das Welterbekomitee die endgültige Entscheidung trifft.
Ein weiterer wichtiger Teil der Operational Guidelines betrifft den Schutz und die Verwaltung der Welterbestätten. Staaten müssen nachweisen, wie sie ihre Stätten rechtlich, organisatorisch und praktisch bewahren wollen, etwa durch Managementpläne oder gesetzliche Schutzmaßnahmen. Außerdem schreibt die UNESCO regelmäßige Berichte über den Zustand der Stätten vor. Wenn der Erhaltungszustand gefährdet ist – zum Beispiel durch Kriege, Naturkatastrophen, Klimawandel oder zu starken Tourismus – kann eine Stätte auf die Liste des gefährdeten Welterbes gesetzt werden. In seltenen Fällen ist auch der Entzug des Titels möglich.
Die Operational Guidelines werden in regelmäßigen Abständen überarbeitet, damit sie aktuellen Herausforderungen gerecht werden und die Grundidee des Welterbe-Übereinkommens – den Schutz von Kultur- und Naturstätten von außergewöhnlicher Bedeutung für die gesamte Menschheit – auch in Zukunft wirksam bleibt.
Was macht eine Heritage Consultant genau?
Eine Heritage Consultant berät und begleitet Projekte im Bereich Kulturerbe – von der Potentialanalyse historischer Stätten bis zur Entwicklung von Managementplänen, Nominierungen für die UNESCO-Welterbeliste oder Heritage Impact Assessments (HIA). Ziel ist, kulturelles Erbe fachlich fundiert zu bewahren und gleichzeitig zukunftsfähig und nachhaltig zu gestalten.
Können Sie bei einem Nominierungsverfahren für die UNESCO-Welterbeliste unterstützen?
Ja – Nominierungen gehören zu meinen Kernkompetenzen. Ich begleite den gesamten Prozess: von der ersten Idee über die Erstellung des Nominierungsdossiers bis zur Einreichung, in enger Abstimmung mit allen Beteiligten und unter Berücksichtigung der aktuellen UNESCO-Richtlinien. Auch die Evaluierungen von bereits erstellten Dossiers und Managementplänen ist möglich.
Was ist ein Heritage Impact Assessment (HIA) und wann ist es erforderlich?
Ein HIA ist eine Kulturerbe-Verträglichkeitsprüfung, die die Auswirkungen geplanter Projekte auf den außergewöhnlichen universellen Wert einer Welterbestätte untersucht. Die UNESCO oder ICOMOS fordern ein HIA häufig, wenn Bau- oder Infrastrukturvorhaben in oder in der Nähe einer Welterbestätte geplant sind. Ebenfalls kann es notwendig sein, wenn vor Ort keine Einigkeit erzielt werden kann über die Auswirkungen auf die Welterbestätte.
Arbeiten Sie nur international oder auch auf nationaler/regionaler Ebene?
Ich arbeite sowohl international als auch innerhalb Deutschlands und auf regionaler Ebene. Viele Projekte erfordern eine enge Verzahnung von internationalen Standards mit lokalen Gegebenheiten und Akteuren.
Können Sie auch kurzfristig in ein laufendes Projekt einsteigen?
Ja, sofern es die Komplexität und der Projektstand erlauben. Ich übernehme häufig Koordinations-, Moderations- oder Beratungstätigkeiten in Projekten, die bereits begonnen haben. Unterstützend aber auch komplette Projekte.
Bieten Sie Schulungen oder Workshops an?
Ja – ich biete praxisorientierte Trainings zu Themen wie UNESCO-Verfahren, Managementplanung, HIA-Methodik, Besucherlenkung oder GIS-gestützte Analysen an. Diese können online oder vor Ort stattfinden. Es ist sinnvoll Kapazität und Wissen an der Stätte aufzubauen um die Stätten langfristig und sicher zu koordinieren.
Welche Vorteile hat die Zusammenarbeit mit Ihnen?
Sie profitieren von einer Kombination aus internationaler Fachkompetenz, interdisziplinärer Zusammenarbeit und praxisnaher Umsetzungserfahrung. Zudem bringe ich ein großes Netzwerk an Expert:innen aus Denkmalpflege, Architektur, Tourismus, Archäologie und GIS mit.